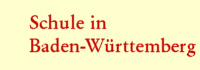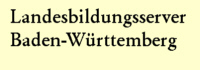Leiter des Seminars: Manfred Deffner |
Leitgedanken für das Schülerseminar an der Musikhochschule in StuttgartKurzgesagt, es ist zunächst eine ganz normale Informatik-AG, in der das Arbeiten mit dem Computer im Mittelpunkt steht. Die Teilnehmer sind allerdings eine Auswahl von Schülern, die nach der amtlichen Definition als "besonders befähigt" gelten. Sie kommen aus dem Großraumgebiet um Stuttgart. Was diese Schüler auszeichnet, ist vordergründig nicht so sehr eine "besondere Begabung" sondern schlicht ihre Arbeitshaltung. Sie entwickeln Teamgeist, verfolgen eine Aufgabe bis zum Ziel, sind bereit, auch im Selbststudium sich die nötigen Kenntnisse zu erarbeiten. Das ist besonders von Bedeutung, wenn die Anforderungen die Grenzen des Schulwissens überschreiten. Und nicht zu vergessen: Sie haben Spaß daran, mit dem Computer zu arbeiten, wobei die Betonung auf "arbeiten" liegt. Die Seminar-Veranstaltungen finden im Studio für Elektronische Musik und Computermusik in der Hochschule statt. Das impliziert natürlich die Berührungsnähe von Computer und Musik, zumal die dazu nötigen Gerätschaften verfügbar sind. Deshalb haben viele der Projekte etwas mit Musik zu tun. Es gibt aber auch Projekte anderer Art, die zur Lösung von praxisbedingten Problemen dienen (Grafik, Netzwerk, Internet, Web-Design, Computer-Hardware, etc.) Wer kann an diesem Seminar teilnehmen? Grundsätzlich ist das Seminar für alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ab Klassenstufe 8 offen. Interessenten sollten allerdings im Großraum Stuttgart ortsansässig sein. Das ist nur eine verkehrstechnische Vorgabe, die auch Ausnahmen zulässt. Das zuständige Oberschulamt weist in gewissen Zeitabständen in einer Ausschreibung die Schulleitungen der Gymnasien auf das Seminar hin. Die Teilnehmer arbeiten, in Gruppen aufgeteilt, an zwei Nachmittagen (Zeitumfang 2 Stunden) der Woche. Die Terminlage richtet sich nach den Studenplanvorgaben der Schüler und den Projektinhalten. Über die Seminar-Sitzungen hinaus findet ein reger Gedanken- und Informationsaustausch über das Internet statt. Es gibt keine Auswahltests oder Prüfungen. Die Teilnehmer qualifizieren sich durch ihre Projektarbeit, die im stetigen Wettbewerb und mit Anregungen in der Gruppe abläuft. Die Projekte (Programme) müssen in einer Dokumentationsschrift festgehalten werden. Wie bewältigen die Schüler diese erhöhten Anforderungen zusätzlich zu den normalen Schulpflichten (Hausaufgaben, Klassenarbeiten, etc.)? Ganz einfach: Sie können offenbar ihre Zeit gut einteilen, um sie für wichtige Dinge zu verwenden. Man sollte vermuten, dass diese Mehrbelastung die Leistungen in der Schule beeinträchtigt. Das Gegenteil ist oft der Fall. Wer im Seminar erfolgreich arbeitet, profitiert davon auch für den Schulbereich. Wer glaubt, dass er das schafft, kann sich mit gutem Gewissen zum Kreis der "besonders befähigten Schülerinnen und Schüler" zählen und er ist bei uns im Seminar willkommen! Manfred Deffner Mai 2003
Computer-Kultur und Computer-KultDer Computer war ursprünglich als ein offenes System zur Lösung aller nur denkbaren Aufgaben gedacht. Das soll er auch bleiben. Der Markttrend bewegt sich aber bedauerlicherweise immer mehr in Richtung "Medienmaschine". Wem Videoclips und Werbespots im Fernsehen zu langweilig sind, der kann dann mit Hilfe des Computers auf zeittötende Spiele (Schach ausgenommen) ausweichen. Die Kreativität bleibt auf der Strecke, der Frust wächst dafür umso mehr. Der Computer kann nicht selber denken. Das war auch nie die Intention der Erfinder. Er kann nur die Denkarbeit abnehemen; die Betonung liegt dabei auf dem Begriff "Arbeit". Wiederkehrende Algorithmen und Schleifen erledigt der Computer mit viel Fleiß und Präzision. Für den Menschen sind solche Tätigkeiten ermüdend und führen dadurch leicht zur Fehlerhaftigkeit. Kreativ und intelligent können nur die Programme sein, nicht der Computer. Dafür trägt der Programmierer die Verantwortung. Denkfehler, mangelnde Kreativität oder Intelligenz fallen immer auf den Programmschreiber zurück. Der Computer hält uns permanent den Spiegel des eigenen Gelingens oder Scheiterns vor Augen. Es wird gelegentlich die Frage gestellt, ob der Computer als typisches Geschöpf der Technik etwas in unseren Bildungsstätten (Gymnasium) zu suchen habe. Nicht der Computer ist das Problem, sondern der Umgang mit ihm. Und das ist doch eindeutig eine Aufgabe für das Erziehungs- und Bildungswesen. Dezember 1995 (gekürzte Fassung) Manfred Deffner |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
||||